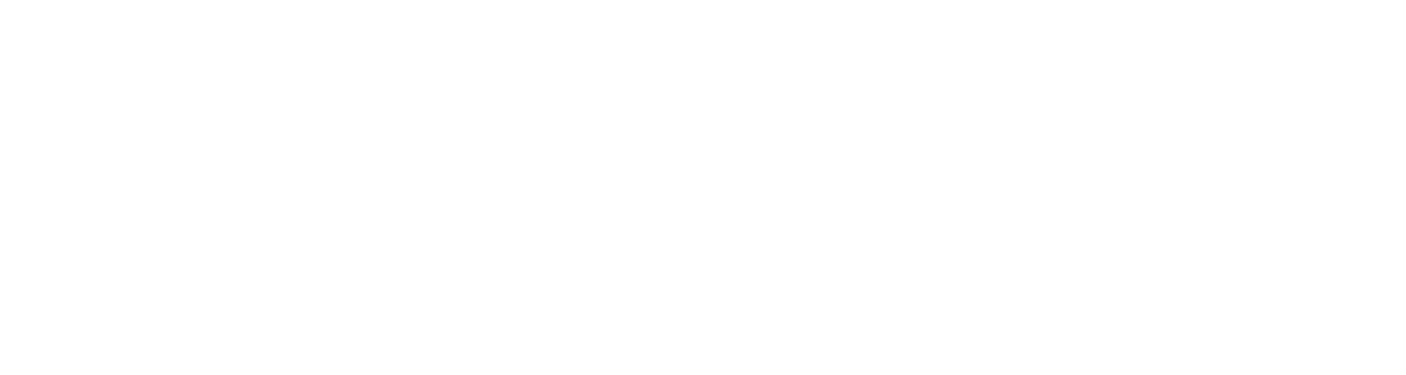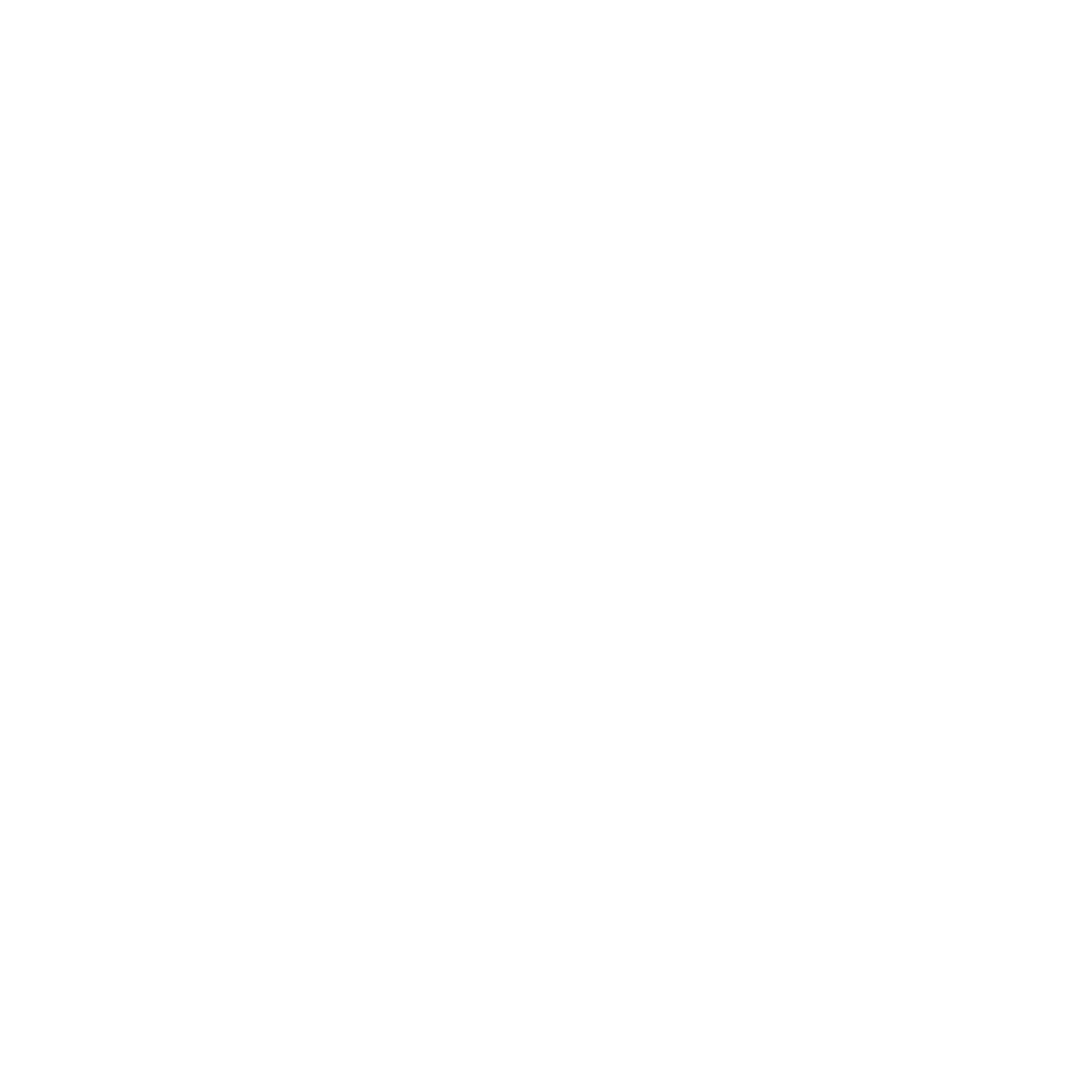Berufspädagogische Grundausbildung (Bestandsschutz) für Praxisanleitungen im MT-Bereich
Ausnahmeregelung bis Februar 2026
Haben Sie die Frist für den Bestandsschutz verpasst?
Viele langjährige Fachkräfte drohen ihren Status als Praxisanleiter zu verlieren, weil sie die erforderlichen Stunden nicht fristgerecht nachgewiesen haben. Hier kommen wir ins Spiel.
Als spezialisierter Bildungsträger unterstützen wir Sie nicht nur bei der Weiterbildung, sondern auch bei der Bürokratie. Wir setzen uns direkt mit der zuständigen Bezirksregierung in Verbindung und beantragen für Ihre Fachkräfte eine Ausnahmeregelung.
Ihr Vorteil: Durch diese Sonderregelung können Ihre Mitarbeiter die 72 berufspädagogischen Stunden noch bis Februar 2026 nachholen, um vollumfänglich von der Bestandsschutz-Regelung zu profitieren.
Live-Online | 72 Unterrichtsstunden | Januar 2026 | 09:00–16:00 Uhr | 2.500 €
Dieser kompakte Live-Online-Kurs qualifiziert Medizinische Technologen*innen – insbesondere aus Radiologie und Labor– für die Aufgabe als Praxisanleitung im Rahmen des Bestandsschutzes. In 72 Unterrichtsstunden werden alle berufspädagogisch relevanten Inhalte vermittelt, damit Praxisanleitungen Auszubildende rechtssicher, strukturiert und kompetenzorientiert an die Aufgaben einer Fachkraft heranführen können.
Warum dieser Kurs?
-
Bestandsschutz sichern: Nachweisbare Qualifikation speziell für Praxisanleitungen im Bestandsschutz.
-
Praxisnah & rechtssicher: Gesetzliche Grundlagen, Dokumentation, Methoden der Anleitung – kompakt und sofort anwendbar.
-
Zertifikat inklusive: Am Ende erhältst du ein Zertifikat, das bei örtlichen Gesundheitsämtern bzw. Bezirksregierungen vorgelegt werden kann.
-
Erfahrener Anbieter: Über 21.100 begleitete Fachkräfte – wir wissen, was in der Praxis zählt.
Zielgruppe
Medizinische Technolog*innen (Radiologie & Labor) sowie weitere MT-Berufsgruppen, die als Praxisanleitungen im Bestandsschutz eingesetzt werden.
Format & Termine
-
Live-Online (virtuelles Klassenzimmer)
-
Zeitraum: Januar 2026, jeweils 09:00–16:00 Uhr
-
Umfang: 72 Unterrichtsstunden (à 45 Min.)
Hinweis: Unterrichtstage liegen innerhalb des genannten Zeitraums; der detaillierte Terminplan wird mit der Anmeldebestätigung übermittelt.
Inhalte (Auszug)
-
Gesetzgebung & Rollenverständnis: rechtliche Grundlagen, Pflichten & Verantwortlichkeiten der Praxisanleitung
-
Didaktik & Methoden: Anleitungsmodelle, Strukturierung von Praxisphasen, Transfer in den Arbeitsalltag
-
Kompetenzorientierung: Lernziele formulieren, Beobachten & Einschätzen, Feedback geben
-
Dokumentation & Nachweise: rechtssichere Dokumentation der Anleitung und Leistungsentwicklung
-
Kommunikation & Begleitung: motivieren, anleiten, herausfordernde Situationen professionell lösen
Abschluss & Nachweis
-
Zertifikat der berufspädagogischen Grundausbildung (Bestandsschutz)
-
Geeignet zur Vorlage bei Gesundheitsämtern bzw. Bezirksregierungen.
Investition
-
2.500 € (Live-Online, inkl. Zertifikat)
Anbieter
Social Media
Weiterbildung für Praxisanleiter nach MTBG und MTAPrV: Bestandsschutz sichern & Ausnahmeregelung bis 2026
Die Praxisanleitung in den medizinisch-technischen Berufen (MT-Bereich) hat durch das neue MT-Berufe-Gesetz (MTBG) und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (MTAPrV) seit 2023 erheblich an Bedeutung gewonnen. Für Einrichtungen bedeutet dies: Ohne qualifizierte Anleitung keine Auszubildenden.
Dieser Artikel erklärt detailliert, was Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter tun, welche strengen gesetzlichen Vorgaben gelten und warum eine Weiterbildung essentiell ist. Sie erfahren alles über die Voraussetzungen (z.B. 300 Stunden Zusatzqualifikation) und den kritischen Bestandsschutz.
Besonders wichtig für Spätentschlossene: Wir beleuchten eine spezielle Ausnahmeregelung, die es Ihren Fachkräften ermöglicht, versäumte Stunden noch bis Februar 2026 nachzuholen. Lesen Sie weiter, um zu verstehen, wie Sie hohe Folgekosten vermeiden und Ihre Ausbildungseinrichtung zukunftsfähig machen.
Der Rettungsanker: Ausnahmeregelung bei verpasstem Bestandsschutz
Viele Einrichtungen stehen kurz vor Ende des Jahres vor einem Problem: Die Fristen für den Bestandsschutz laufen ab oder wurden verpasst. Normalerweise würde dies bedeuten, dass erfahrene Kräfte ihren Status verlieren und die komplette, zeitaufwendige Neuausbildung durchlaufen müssten.
Wir haben die Lösung für Sie: Sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter die Fristen verpasst haben, setzen wir uns als Ihr Bildungspartner direkt mit der zuständigen Bezirksregierung in Verbindung. Wir beantragen für Ihre Kräfte eine Ausnahmeregelung.
Ihr Vorteil: Durch diesen Antrag können Ihre Mitarbeiter die fehlenden 72 berufspädagogischen Stunden noch bis Februar 2026 nachholen, um nachträglich voll von der Bestandsschutz-Regel zu profitieren. Dies spart Ihrem Unternehmen hunderte Arbeitsstunden und tausende Euro.
Was versteht man unter Praxisanleitung in medizinisch-technischen Berufen?
Unter Praxisanleitung versteht man die gezielte, pädagogisch fundierte Anleitung von Auszubildenden in deren praktischem Ausbildungsteil durch speziell qualifizierte Fachkräfte.
Die Aufgaben sind im § 20 MTBG klar definiert und vielfältig:
-
Heranführung an die Praxis: Die praxisanleitende Person führt Auszubildende schrittweise an die praktischen und berufsspezifischen Tätigkeiten in der medizinischen Technologie heran.
-
Lernbegleitung: Sie begleitet den Lernprozess während der gesamten praktischen Ausbildung und steht unterstützend zur Seite.
-
Bindeglied: Die Praxisanleitung fungiert als Schnittstelle zwischen Schule und Betrieb. Sie tauscht sich mit Lehrkräften über Lerninhalte aus und gewährleistet den Transfer des im Unterricht Gelernten in die Praxis.
-
Methodenkompetenz: Sie fördert die fachliche Kompetenz und entwickelt Methoden für selbstorganisiertes Lernen.
Kurz gesagt: Praxisanleitende Personen sind die Garanten dafür, dass aus Auszubildenden kompetente Fachkräfte werden.
Welche neuen gesetzlichen Vorgaben gelten seit 2023 (MTBG und MTAPrV)?
Zum 1. Januar 2023 trat das novellierte MTBG in Kraft, begleitet von der MTAPrV. Diese Reform hat die ehemaligen MTA-Berufe zu „Medizinischen Technologinnen und Technologen“ (Labor, Radiologie, Funktionsdiagnostik, Veterinärmedizin) modernisiert und die Praxisanleitung erstmals als eigenständiges pädagogisches Aufgabenfeld gesetzlich verankert.
Die wichtigsten Neuerungen:
1. Qualitätsstandards: Die praktische Ausbildung darf nur in Einrichtungen stattfinden, die eine angemessene Betreuung garantieren.
2. Die 15 %-Quote: Mindestens 15 % der praktischen Ausbildungszeit müssen durch eine qualifizierte praxisanleitende Person betreut werden. Dies ist ein Paradigmenwechsel, da zuvor kein fester Prozentsatz galt. Bis 2030 müssen alle Bundesländer diese Quote erfüllen (Übergangsweise sind oft 10 % zulässig).
3. Attraktivitätssteigerung: Abschaffung des Schulgeldes und Einführung einer Ausbildungsvergütung zur Fachkräftesicherung.
Träger der praktischen Ausbildung (Kliniken, Labore) müssen nun Ausbildungspläne erstellen und Kooperationen schließen. Wichtig: Ohne qualifizierte Praxisanleiter darf keine praktische Ausbildung stattfinden.
Welche Voraussetzungen muss eine Praxisanleiterin oder ein Praxisanleiter erfüllen?
Die MTAPrV (§ 8) definiert vier klare Kriterien für die Eignung als Praxisanleitung:
1. Berufsabschluss: Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung (als Medizinischer Technologe nach neuem Recht oder MTA nach altem Recht).
2. Berufserfahrung: Mindestens ein Jahr Berufserfahrung im entsprechenden Berufsfeld. Frisch examinierte Kräfte müssen erst Erfahrung sammeln.
3. Pädagogische Zusatzqualifikation (300 Stunden): Absolvierung einer berufspädagogischen Weiterbildung im Umfang von mindestens 300 Stunden.
Hinweis: Bestimmte Hochschulabschlüsse (Bachelor/Master in Medizin- oder Pflegepädagogik) werden als gleichwertig anerkannt.
4. Fortbildungspflicht: Jährliche berufspädagogische Fortbildungen im Umfang von mindestens 24 Stunden.
Nur wer alle Punkte erfüllt (oder unter den Bestandsschutz fällt), darf die Tätigkeit ausüben.
Was bedeutet der Bestandsschutz konkret?
Der Bestandsschutz (§ 8 Abs. 2 MTAPrV) verhindert, dass langjährige Praxisanleiter ihre Qualifikation verlieren, nur weil sie die neuen 300 Stunden nicht absolviert haben.
Wer genießt Bestandsschutz?
-
Personen, die im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 bereits als Praxisanleitung tätig waren.
-
Personen, die am 31.12.2022 über die notwendigen Kompetenzen verfügten (z.B. durch alte Weiterbildungen/Altgesetze).
Das bedeutet für diese Gruppe: Sie sind von der 300-Stunden-Zusatzqualifikation befreit. Sie müssen jedoch zwingend:
1. Ihren Status der Behörde melden/nachweisen.
2. Eine gültige Berufsurkunde besitzen.
3. Die jährlichen Fortbildungen (24 Stunden) absolvieren.
Viele „Bestands-Anleiter“ haben genau diese Fortbildungen in der Übergangsphase versäumt. Hier greift unser Angebot: Wir helfen Ihnen, über die Bezirksregierung die Nachholfrist bis Februar 2026 zu erwirken.
Warum müssen Ausbildungsbetriebe jetzt handeln? (Kosten-Nutzen)
Für Ausbildungsbetriebe besteht akuter Handlungsbedarf. Seit 2023 ist der Einsatz von Azubis ohne qualifizierte Anleitung illegal.
Die Risiken des Nicht-Handelns:
-
Ausbildungsstopp: Behörden können die Ausbildung untersagen, wenn die Quote oder Qualifikation fehlt.
-
Fachkräftemangel: Ohne Azubis fehlt der Nachwuchs.
-
Hohe Kosten: Externe Fachkräfteakquise ist teuer.
Die Kostenrechnung: Eine Weiterbildung kostet ca. 2.500 Euro. Das „Verpassen“ der Qualifizierung kostet Sie jedoch weit mehr: Wenn ein Mitarbeiter den Bestandsschutz verliert und die vollen 300 Stunden nachholen muss, fällt er für ca. 218 zusätzliche Stunden aus (Differenz zu den 72h Refresher). Bei einem durchschnittlichen MT-Gehalt sind das über 6.000 Euro reine Lohnkosten für die Ausfallzeit. Fazit: Die rechtzeitige Qualifizierung (oder Rettung über die Ausnahmeregelung) ist die wirtschaftlich einzig sinnvolle Entscheidung.
Wie läuft die 300-Stunden-Weiterbildung ab?
Für neue Praxisanleiter ohne Bestandsschutz ist die 300-Stunden-Qualifikation der Königsweg.
Anbieter: Fachschulen und spezialisierte Zentren wie das Refresher-Zentrum NRW.
Inhalte: Lernpsychologie, Methodik/Didaktik, Kommunikation, Konfliktmanagement, Recht, Beurteilungswesen.
Format:
In NRW sind max. 25 % Online-Unterricht (als Ersatz für Präsenz) erlaubt.
Wir bieten Blended-Learning (Hybrid) oder Live-Online-Kurse (mit hohem Interaktionsgrad) an. Bitte prüfen Sie bei 100% Online-Kursen immer die Akzeptanz in Ihrem Bundesland (in NRW oft als Live-Webinar akzeptiert).
Abschluss: Zertifikat mit Ausweis aller Module und Stunden.
Welche Fortbildungen (24 Stunden) sind nötig?
Neben der Grundqualifikation fordert § 8 Abs. 1 Nr. 4 MTAPrV eine kontinuierliche Fortbildung.
-
Umfang: Mindestens 24 Stunden jährlich.
-
Flexibilität: Viele Bundesländer (z.B. NRW, Berlin) erlauben einen Dreijahreszeitraum (72 Stunden). Das schafft Flexibilität, darf aber nicht zum „Aufschieben“ verleiten.
-
Inhalte: Neue Lehrmethoden, Generation Z, Recht, Feedbackkultur.
-
Wichtig: Selbststudium zählt nicht! Es muss geführter Unterricht sein (Präsenz oder Live-Online).
Unternehmen müssen diese Fortbildungen dokumentieren (Fortbildungsregister), da Behörden diese bei Prüfungen anfordern.
Wie können sich Unternehmen anmelden?
Das Refresher-Zentrum NRW unterstützt Sie dabei, noch in diesem Jahr (oder im Rahmen der Ausnahmeregelung bis Februar 2026) die nötigen Qualifikationen zu erlangen.
Unsere Kursformate:
1. Blended-Learning (Hybrid): Kombination aus Live-Online (Zoom) und Präsenzphasen an zentralen Orten in NRW.
2. Online-Live-Kurs: Vollständige Durchführung via Zoom (bitte Landesvorgaben prüfen).
Nächster Start (Herbst 2025): Die Online-Seminare startet im Januar 2026 und findet jeweils vom 09:00 – 16:00 Uhr statt. Die Präsenztermine werden individuell abgestimmt.
Anmeldung: Über www.refresher-zentrum.de. Wir benötigen mindestens 20 Teilnehmer für den Start. Sollten Sie nur einzelne Module benötigen (um Lücken für den Bestandsschutz zu füllen), kontaktieren Sie uns direkt für eine maßgeschneiderte Lösung.
Zusammenfassung: Das Wichtigste in Kürze
-
Pflicht: Neue Gesetze (MTBG/MTAPrV) fordern qualifizierte Praxisanleiter (300h Kurs oder Bestandsschutz).
-
Rettungsanker: Bei verpassten Fristen beantragen wir für Sie eine Ausnahmeregelung bis Februar 2026 bei der Bezirksregierung.
-
Voraussetzungen: Berufsabschluss, 1 Jahr Erfahrung, päd. Qualifikation, 24h Fortbildung jährlich.
-
ROI: Weiterbildung (ca. 2.500 €) spart > 6.000 € an Folgekosten durch Arbeitsausfall.
-
Handeln: Melden Sie Ihre Mitarbeiter jetzt an, um die Ausbildungsbefugnis Ihres Unternehmens zu sichern.
Möchten Sie den Bestandsschutz Ihrer Mitarbeiter retten? Kontaktieren Sie uns noch heute.